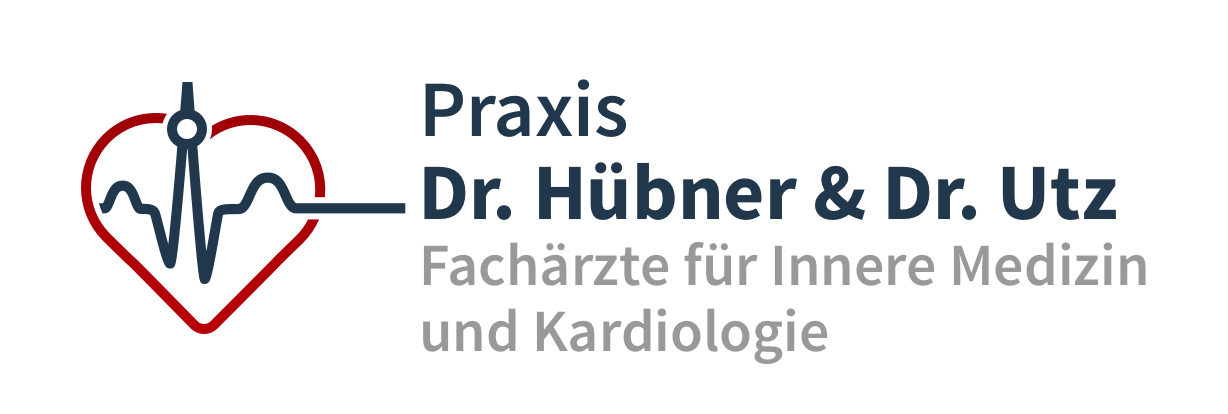Klare Sache: Wenn plötzlicher Brustschmerz als Ausdruck eines akut verschlossenen Herzkranzgefäßes einsetzt, liegt die alleinige Rettung in der notfallmäßigen Wiedereröffnung des Gefäßes im Herzkatheter (alternativ: Notfall- Bypass Operation). Hier gilt der Grundsatz: Zeit ist Herzmuskel. Eine Erfolgsgeschichte ist die Verringerung der Herzinfarktsterblichkeit in Deutschland in den letzten 25Jahren um mehr als 50%. Laut Herzbericht 2017 ist dies unter anderem auf Verbesserungen in den Versorgungsstrukturen zurückzuführen, die eine Verkürzung der Zeitspanne zwischen Schmerzbeginn und Wiedereröffnung des verschlossenen Gefäßes im Herzkatheterlabor ermöglichen.
Unklare Angelegenheit: Weniger eindeutig ist das Vorgehen, wenn regelmäßig wiederkehrende Brustschmerzen (Angina pectoris) im Rahmen einer stabilen koronaren Herzkrankheit auftreten. Lange Zeit war in dieser Situation der visuelle Verengungsgrad des Herzkranzgefäßes in der angiographischen Darstellung maßgeblich für die Entscheidung, ob die Engstelle durch eine Gefäßstütze (Stent) überbrückt werden sollte. Als Ausdruck dieser hierzulande immer noch gängigen Praxis nimmt Deutschland mit ca. 900.000 pro Jahr (2016) durchgeführten Herzkatheterunter-suchungen eine Spitzenposition im internationalen Vergleich ein. Nur zu einem Bruchteil der Fälle (2016 in ca. 40%) war die angiographische Darstellung im Herzkatheter dann auch mit einer Intervention am Koronargefäß, d.h. einer Ballonaufdehnung oder Stentimplantation, verbunden.
Doch was ist der Nutzen für die so behandelten Patienten? Gegenüber einer alleinigen optimal- medikamentösen Versorgung besteht jedenfalls kein prognostischer Vorteil in harten klinischen Endpunkten wie Sterblichkeit oder der Wahrscheinlichkeit eines akuten Herzinfarktes (COURAGE Studie). Die Rate erneuter ungeplanter Herzkathetereingriffe, z. B. nach stationärer Aufnahme wegen instabiler Angina pectoris, konnte hingegen signifikant gesenkt werden (FAME II – Studie). Dies galt allerdings nur für Patienten, deren verengtes Koronargefäß vor Stentimplantation nicht nur visuell beurteilt worden war, sondern der Nachweis einer tatsächlichen Flußbehinderung zuvor mit einer entsprechenden Messung (fraktionelle Flußreserve – FFR) im Rahmen der Herzkatheteruntersuchung erbracht worden war.
Wenn also die prognostischen Vorteile durch die Herzkathetertherapie eher übersichtlich bleiben, wie überlegen ist sie dann gegenüber einer optimal- medikamentösen Therapie zumindest in Bezug auf die Verringerung von Angina pectoris Beschwerden? Hier hat die vor kurzem veröffentlichte ORBITA Studie die allgemeine Ansicht einer effektiven Schmerztherapie durch den Herzkatheter in Frage gestellt. 2 Patientengruppen mit stabiler Angina pectoris und nach FFR Messung signifikant verengtem Herzkranzgefäß wurden nach Herzkathetertherapie verglichen. Allerdings erhielt nur die eine Gruppe tatsächlich einen Stent, bei der anderen wurde ein Scheineingriff (ohne Stent) durchgeführt. Sechs Wochen nach Eingriff war zwischen den Gruppen kein signifikanter Unterschiede bzgl. der Angina pectoris Beschwerden oder einer verbesserten Belastbarkeit nachweisbar. Allerdings lag bei den eingeschlossenen Patienten nur eine koronare Eingefäßerkrankung vor, d.h. nur in einem von drei Herzkranzgefäßen bestand überhaupt eine relevante Verengung. Das Ausmaß der damit verbundenen Mangeldurchblutung in Relation zum gesamten Herzmuskel war somit im Durchschnitt auch nur geringgradig, wie zuvor durchgeführte nicht-invasive Tests gezeigt hatten. Was bedeuten nun diese Ergebnisse im Hinblick auf das optimale Vorgehen für den einzelnen Patienten?
Dazu der Kardiologe Dr. Utz: Real-life Patienten entsprechen oft nicht dem hochselektierten Patientengut, das in Studien eingeschlossen wird. Trotz dieser neuen beachtenswerten Daten gibt es keinen Grund, bei der Auswahl von Patienten, die vermutlich vom Herzkatheter profitieren, von dem in den Leitlinien empfohlenen Vorgehen abzuweichen. Dazu gehört die sorgsame Einschätzung des individuellen Krankheitsrisikos und des potentiellen Benefits einer Herzkathetertherapie als Grundlage für eine gemeinsame Entscheidungsfindung mit dem Patienten.